ZUKUNFT BEGINNT
MIT FORSCHUNG.
Praxisorientierte Forschung auf höchstem Niveau hat im FEhS-Institut Tradition. Unsere Expertinnen und Experten und Labore, die fachübergreifende Teamarbeit sowie unser weit verzweigtes Netzwerk aus Industrie, Behörden und Universitäten machen uns zu begehrten Partnern bei internationalen Forschungsprojekten.
Wir stellen Ihnen im Folgenden eine aktuelle Auswahl vor.
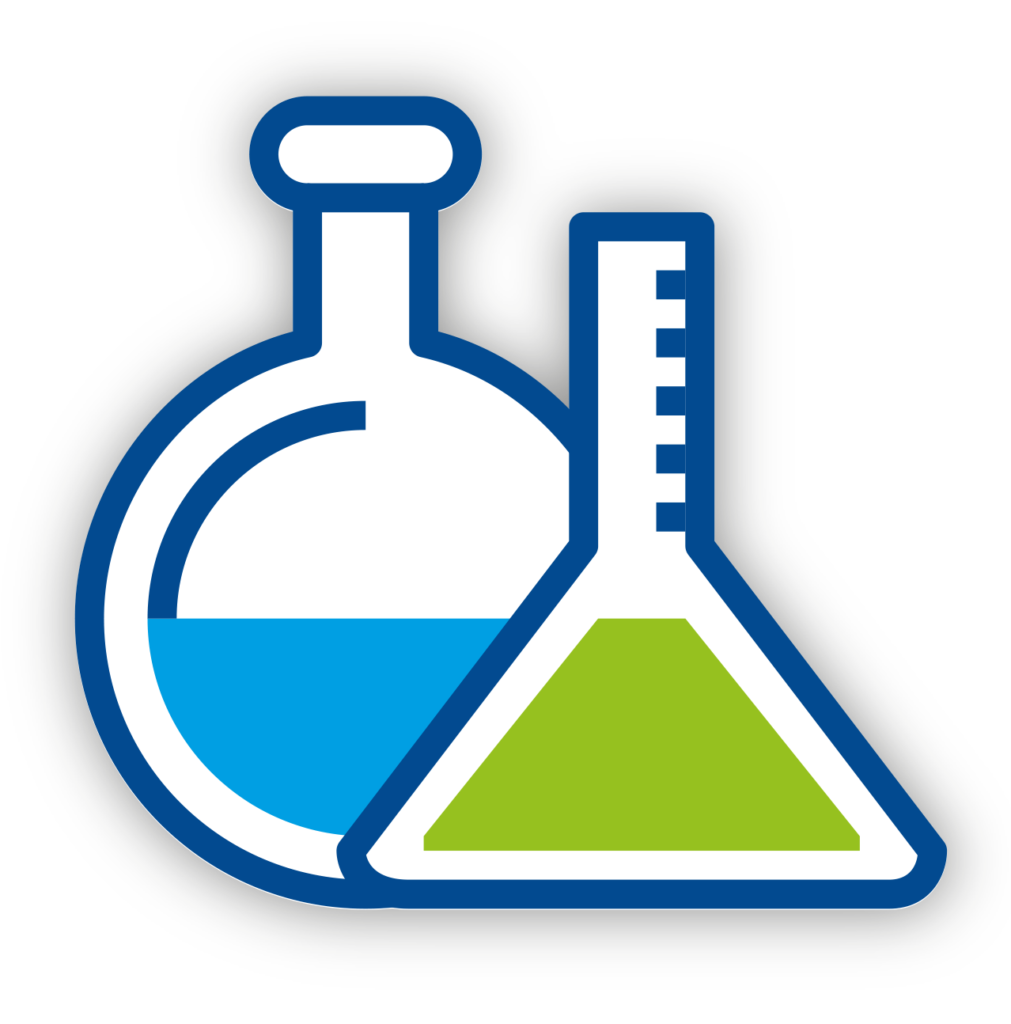

SchlaGie
SchlaGie – Nutzung von Schlacke zur Energierückgewinnung für das lokale Fernwärmenetz
Wie lässt sich industrielle Abwärme sinnvoll für die kommunale Wärmeversorgung nutzen? Das Forschungsprojekt SchlaGie geht dieser Frage nach – mit einem besonderen Fokus auf die thermische Energie in Form von Schlacke. Seit April 2025 arbeiten Experten aus verschiedenen Disziplinen daran, ein neuartiges Verfahren zu entwickeln, das diese bislang verlorene Wärme für lokale Fernwärmenetze nutzbar macht.
Projektfokus: Energie aus unvermeidbarer Abwärme
Im Zentrum steht die sogenannte LD-Schlacke – ein Nebenprodukt der Stahlherstellung, das beim Abkühlen in offenen Beeten große Mengen Strahlungswärme freisetzt. Diese Energie bleibt bisher ungenutzt. SchlaGie will das ändern: Am Beispiel des Standorts Duisburg wird ein berührungsloses Verfahren zur Wärmeaufnahme entwickelt und getestet. Ziel ist es, die Wärme direkt in das lokale Fernwärmenetz einzuspeisen und so den Anteil industrieller Abwärme in der kommunalen Versorgung deutlich zu steigern.
Warum das wichtig ist
Die Stahlindustrie gehört zu den größten Erzeugern unvermeidbarer Abwärme – sowohl bei der Roheisenerzeugung als auch bei der Weiterverarbeitung zu Stahl. Technische und wirtschaftliche Hürden haben bislang verhindert, dass diese Energie umfassend genutzt wird. Dabei liegt allein im Duisburger Raum ein theoretisches Wärmepotenzial von bis zu 280.000 MWh pro Jahr – das entspricht einer möglichen Einsparung von 56.000 Tonnen CO₂, wenn man Erdgas als Vergleich heranzieht.
Projektziele im Überblick
- Technologieentwicklung: Aufbau eines Demonstrators zur berührungslosen Wärmeaufnahme aus Schlackenbeeten.
- Stoffanalyse & Simulation: Untersuchung der chemischen und thermophysikalischen Eigenschaften der Schlacke sowie Simulation realer Bedingungen im Labor.
- Integration in Wärmenetze: Einbindung der gewonnenen Energie in bestehende und neue Fernwärmesysteme.
- Übertragbarkeit: Prüfung der Anwendbarkeit auf andere industrielle Prozesse mit vergleichbarer Abwärme – etwa in Gießereien, Kraftwerken oder der Zementindustrie.
Ein Beitrag zur klimaneutralen Stadtentwicklung
SchlaGie zeigt, wie industrielle Prozesse und kommunale Infrastruktur intelligent verknüpft werden können. Die Projektergebnisse sollen nicht nur die Energieeffizienz der Stahlproduktion verbessern, sondern auch die kommunale Wärmeplanung unterstützen – und damit einen wichtigen Baustein für die klimaneutrale Transformation von Städten und Regionen liefern.
Projektpartner
- thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH (Koordination)
- C-Technik GmbH
- Fraunhofer UMSICHT
- THGA – Technische Hochschule Georg Agricola
Laufzeit und Förderung
Die Projektzeitraum ist April 2025 bis März 2028 und eine Projektförderung erfolgt durch die Europäische Union sowie das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027, Förderaufruf ENERGIE.IN.NRW unter dem Förderkennzeichen EFRE-20800783.


David Algermissen M.Sc.
Abteilungsleiter Sekundärrohstoffe und Schlackenmetallurgie
+49(0)2065-994512
d.algermissen@fehs.de

InSGeP
Im Projekt InSGeP (Investigations of Slags from Next Generation Steel Making Processes) untersuchen fünf Stahlwerke, sechs Forschungseinrichtungen und zwei Anlagenbauer Schlacken aus der zukünftigen Stahlherstellung: die auf DRI/HBI basieren bzw. aus dem HPSR Verfahren. Dafür sollen weltweit Schlacken aus ähnlichen Prozessen zusammengetragen und charakterisiert werden, um typische Bandbreiten an chemischer und mineralogischer Zusammensetzung zu erhalten. Weiterhin sollen Schlacken im Labor und Technikum erschmolzen werden, welche auf DRI/HBI als Eisenträger basieren. Daraufhin sollen geeignete Anwendungen geprüft und Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.
Koordiniert von: FEhS
Projektkoordinator: David Algermissen
Laufzeit: 01.07.2023 – 30.06.2027
Fördermaßnahme: RFCS
Förderkennzeichen: 101112665

This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel (RFCS) European Commission under grant agreement No. 800762.

SAVE-CO2
Das Projekt SAVE CO2 (Schaffung einer alternativen Verwendung einer auf DRI-Basis erzeugten Elektroofenschlacke für die Zementindustrie zur Verringerung der CO2-Emissionen) widmet sich dieser „neuen“ Schlacke und erforscht die Möglichkeit, ein ähnliches Bindemittel aus den sogenannten SAF Schlacken zu erzeugen. Dies soll auch weiterhin der Zementindustrie als Portlandzementklinkersubstitut zur Verfügung stehen, um so auch zukünftig die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren und beide Industrien weiterhin im Sinne der Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung zu verbinden.
SAVE CO2 erweitert somit die betrachtete Systemgrenze auch über die Stahlindustrie hinaus. So soll ein CO2-Benefit für die deutsche Industrie gesamtheitlich erwirkt werden, was ein weltweites Vorbild für die dekarbonisierte Stahlindustrie mittels Direktreduktionsanlage und SAF sein kann.
Zur Umsetzung dieser Ziele werden im Vorhaben unterschiedliche Qualitäten von direkt reduziertem Eisen aufgeschmolzen und die entstehende Schlacke untersucht. Basierend auf den so gewonnenen Erkenntnissen werden in umfangreichen Labor- und Technikumsversuchen Konzepte entwickelt und erprobt, wie eine zukünftige Konditionierung der Schlacken funktionieren kann. Vielversprechende Konzepte werden anschließend in einem speziell für das Vorhaben angefertigten Elektroofen im größeren Maßstab umgesetzt, um die erforderlichen zement- und betontechnischen Untersuchungen durchführen zu können. Spezialisten für Ökobilanzierungen begleiten das gesamte Vorhaben, um eine fundierte Aussage über die umwelttechnischen Aspekte des entwickelten Verfahrens tätigen zu können.
Koordiniert von: FEhS
Projektkoordinator: David Algermissen
Laufzeit: 01.05.2021 – 31.08..2025
Fördermaßnahme: BMBF – KlimPro Industrie
Förderkennzeichen: 01LJ2004A


DRI-EOS
Der Fokus im Projekt DRI-EOS liegt auf Schlacken, die in Elektrolichtbogenöfen erzeugt werden, in denen hauptsächlich direkt reduziertes Eisen (DRI) eingesetzt wird. Die Verbundpartner suchen Wege, durch gezielte Konditionierung der Schlacken in Kombination mit einer schnellen Abkühlung (nass oder trocken) zu einer glasigen Körnung eine Verwendung in der Zementindustrie zu ermöglichen und so den zukünftig schrittweise nicht mehr verfügbaren Hüttensand zu substituieren. Es werden jedoch auch kristalline Körnungen der Schlacken untersucht und potenzielle Absatzmärkte evaluiert.
- Projekt Akronym: DRI-EOS
- Koordiniert von: FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V.
- Projektpartner:
FRIEDRICH Rohstoffe GmbH
Holcim (Deutschland) GmbH
LOI Thermprocess GmbH
Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) - Projektkoordinator: David Algermissen, M.Sc.
- Laufzeit: Juli 2022 bis Juni 2026
- Förderprogramm: Energierahmenprogramm des BMFTR
- Förderkennzeichen: 03SF06


SYMBIO-STEEL
SymbioSteel ist ein europäisches Forschungsprojekt, das sich mit der Zukunft der Stahlindustrie im Kontext des EU Green Deals beschäftigt. Ziel ist es, neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Industriebranchen zu erschließen, um Ressourcen effizienter zu nutzen, CO₂-Emissionen zu senken und innovative Technologien zu fördern.
Im Zentrum steht das Konzept der industriellen Symbiose – also die gezielte Verknüpfung verschiedener Industriezweige, um Nebenprodukte, Energie und Materialien gemeinsam zu nutzen. Gerade für die Stahlindustrie eröffnen sich dadurch neue Chancen, kritische Rohstoffe zu ersetzen und nachhaltige Produktionsprozesse zu etablieren.
Was macht SymbioSteel besonders?
- Analyse bestehender Synergien zwischen Stahl und anderen Sektoren
- Identifikation neuer Potenziale für sektorübergreifende Kooperationen
- Einbindung relevanter Akteure, um innovative Ansätze in die Praxis zu überführen
- Förderung des Wissensaustauschs und Entwicklung von Strategien zur breiten Umsetzung
Projektziele im Überblick
- Bewertung der Wirkung industrieller Symbiose auf die Stahlbranche anhand definierter Leistungskennzahlen (KPIs)
- Unterstützung der Transformation hin zu CO₂-armen Produktionsprozessen
- Entwicklung praxisnaher Leitlinien für sektorübergreifende Zusammenarbeit
- Förderung junger Talente, die zur technologischen Weiterentwicklung beitragen
Warum ist das wichtig?
Die Stahlindustrie steht im Zentrum der europäischen Industrie und spielt eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Klimaziele. Durch die gezielte Vernetzung mit anderen Branchen können Ressourcen geschont, Innovationen beschleunigt und nachhaltige Lösungen etabliert werden – mit positiven Effekten für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft.
- Projekt Akronym: Symbio-Steel
- Koordiniert von: Scuola Superiore Sant’Anna (Italien)
- Projektpartner:
K1-MET GmbH (Österreich)
Rina Consulting – Centro Sviluppo Materiali SPA (Italien)
SWERIM AB (Svhweden)
FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V. - Ansprechpartner: David Algermissen, M.Sc.
- Laufzeit: Oktober 2024 bis September 2026
- Förderprogramm: Research Fund for Coal and Steel (RFCS)
- Förderkennzeichen: 101156509


R-Rhenania
R-Rhenania – Modifiziertes Rhenania Phosphat aus Klärschlammasche für Bayern
Um die Abhängigkeit von importierten primären Phosphaten für die Landwirtschaft zu reduzieren und die Deponierung von phosphathaltiger Klärschlammaschen zu vermeiden verpflichtet der Gesetzgeber die Betreiber von Kläranlagen zukünftig Phosphat aus der kommunalen Abwasserbehandlung zurückzugewinnen. Das Projekt R-Rhenania beruht auf der Verbrennung phosphathaltiger Klärschlämme mit dem Ziel, die anfallenden Aschen als Düngemittel zu verwenden.
Im Rahmen des Projekts R-Rhenania wurde eine bestehende Klärschlammverbrennungsanlage der Firma Emter so umgerüstet, dass in den Verbrennungsprozess Additive für die thermochemische Umwandlung des im Klärschlamm enthaltenen Phosphats zudosiert werden können. Die Additive bewirken eine Verbesserung der Pflanzenverfügbarkeit des Phosphats sowie eine teilweise Entfrachtung von unerwünschten Spurenelementen. Dieser Prozess ist vom sogenannten AshDec®-Verfahren abgeleitet, bei dem Klärschlammaschen in einem nachgeschalteten Drehrohrofen unter Zugabe von Additiven thermochemisch behandelt werden.
Das FEhS-Institut prüfte in der ersten Projektphase gemeinsam mit der Universität Bonn das erzeugte Düngemittel im Gefäßversuch hinsichtlich Düngewirksamkeit des Phosphats und der Aufnahme von Spurenelementen in die Pflanzen-Biomasse. In der zweiten Projektphase wird am FEhS-Institut anhand eines Kleinlysimeters die Auswaschung von Spurenelementen aus dem Boden geprüft.
Projektkoordination:
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
https://www.bam.de/Content/DE/Projekte/laufend/R-Rhenania/r-rhenania.html

BioKoRed
Projekt BioKoRed – CO₂-neutrales Recycling metallurgischer Reststoffe durch Biokohle-Agglomerate
Das Projekt „BioKoRed“ verfolgt das Ziel, Biokohle als CO₂-neutrales Reduktionsmittel zur Herstellung selbstreduzierender Agglomerate aus eisenhaltigen Reststoffen in Eisengießereien zu etablieren. Dabei werden feinkörnige metallurgische Reststoffe mit biogenen Bindemitteln und Biokohle stempelgepresst und in den Schmelzprozess eines Heißwindkupolofens eingebracht. Die innovative Rezeptur ermöglicht die Rückführung oxidisch gebundener Eisenfraktionen, die bislang deponiert werden mussten, in den Produktionskreislauf und reduziert so den Einsatz von Primärrohstoffen.
Biokohle wird aus bislang ungenutzten biogenen Reststoffen wie Grünschnitt, landwirtschaftlichen Abfällen oder Klärschlamm durch Pyrolyse oder hydrothermale Karbonisierung gewonnen. Ihre Verwendung als Reduktionsmittel senkt Treibhausgasemissionen und spart Emissionszertifikate. Ziel ist die Entwicklung mechanisch stabiler Agglomerate mit hoher Kalt- und Heißdruckfestigkeit sowie einem Metallisierungsgrad von mindestens 85 %, die störungsfrei im Kupolofen verarbeitet werden können.
Das Projekt umfasst die Charakterisierung geeigneter Reststoffe und Biokohlen, die Entwicklung und Optimierung von Rezepturen, Labor- und Technikumsversuche sowie industrielle Tests. Eine ökologische und ökonomische Bewertung erfolgt mittels Life Cycle Analysis und Carbon Footprint-Modellierung. Die Ergebnisse sollen zur Etablierung eines klimafreundlichen Recyclingverfahrens beitragen und neue Einsatzmöglichkeiten für Biokohle in der metallurgischen Industrie erschließen.
Die Projektpartner – klimafarmer GmbH, Isselburg Guss und Bearbeitung GmbH, das IOB der RWTH Aachen und das FEhS Institut – bündeln ihre Expertise in Biokohleproduktion, Gießereitechnik, Industrieofenbau und Baustoffforschung, um gemeinsam einen Beitrag zur Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft zu leisten.

WäGieS
Optimierter Einsatz von Wälzrohrschlacke in Eisengießereien als alternativer Sekundärrohstoff – WäGieS
Im Projekt WäGieS soll der optimierte Einsatz von Wälzrohschlacken aus dem Zn-Recycling als alternativer Sekundärrohstoff in Eisengießereien untersucht werden. Das übergeordnete Ziel ist die Optimierung der Ressourceneffizienz bei gleichzeitiger CO2-Reduktion durch Anwendung des Zero-Waste Ansatzes. Bisher werden diese Schlacken aufgrund ihrer Zusammensetzung und technischen Eigenschaften deponiert. Es ist bekannt, dass Fe aus den Schlacken gewonnen werden kann, das Metall jedoch Störelemente wie Cu, Cr und Zn beinhaltet, was eine Verwendung in der Stahlerzeugung verhindert.
Über eine geometallurgische Bewertung der für die mineralische Aufbereitung kritischen Parametern, wie z.B. die Elementverteilung und Aufschlusskorngrößen, werden in WäGieS Aufbereitungsprozesse entwickelt, um gezielt ein Fe-Konzentrat zu erzeugen. Das Konzentrat wird anschließend zu optimierten selbst-reduzierenden Agglomeraten verarbeitet, um diese zur Herstellung von technischem Gusseisen im Schmelzbetrieb von Eisengießereien zu nutzen. Für das Einstellen der Eigenschaften von Gusseisenlegierungen werden neben dem Fe-Gehalt auch das Ausbringen von Nebenelementen wie Cu untersucht. Die Agglomerate müssen dabei ein hohes Wertstoffausbringen aufweisen, da hohe Anteile an z.B. Ca-Silikaten den Schmelzprozess besonders stören würden. Neben der pyrometallurgischen Nutzung des Fe-Konzentrates wird im Sinne des Zero-Waste Gedankens die Ca reiche Bergefraktion auf einen möglichen Einsatz als alternativer Zementrohstoff erforscht.
Die Untersuchungen werden in enger Abstimmung mit Industrievertretern durchgeführt und durch eine ökologische und ökonomische Bewertung des Gesamtprozesses unter Betrachtung detaillierter Stoff- und Energiebilanzierungen begleitet.
Die Nutzung von Wälzrohrschlacken stellt eine vielversprechende Möglichkeit für KMUs dar, Sekundärrohstoffquellen zu nutzen. Das Projekt WäGieS betrachtet die gesamte Wertschöpfungskette für die Nutzung von bisher deponierten Reststoffen

ActiSlag
The main objectives of the very ambitious project were to understand more precisely which chemical and thermal parameters influence the quality of granulated blast furnace slag (GBS) and its performance in cement and concrete. For that the micro and nanostructure of the amorphous phase, some minor chemical elements beside the major oxides (CaO, SiO2, Al2O3, MgO) and the mechanism of early age hydration have been investigated. The main target was to improve the short-term performance and the performance of cements with high GBS contents. For achieving this target as well „upstream activation“ measurements for the liquid blast furnace slag (= chemical and thermal modifications of the glass structure) during the melting and granulation processes as „downstream activation“ measurements for the solid slag, e. g. the combination with chemical activators (e. g. NaCl, CaCl2, Na2SO4, NaSCN or triethanolamine) have been tested. With respect to the practice a „second generation GBS“ should be developed. Thus, a blast furnace cement CEM III/B with 80 wt.-% ground GBS should show a similar (early) strength performance as a composite cement CEM II with only 20 wt.-% GBS (18-24 MPa after 2 days). The project target have been achieved.
„ActiSlag“ was focused on classical GBS as it is produced and used for cementitious purposes since decades. If the European steel production transformation process will be realized, step by step blast furnaces will be substituted by a combination of direct reduction and electrical smelting processes, based on green hydrogen and green electrical power. Thus, the well-known GBS will vanish, too. Nevertheless, the project results have great relevance also for the new slags. It is a clear task for steel and slag producers to enable also these slags for a utilisation in cement and concrete in order to secure the environmental (lower raw material and primary energy demand, lower CO2 emission) and technical (high durability) advantages of slag containing cements. Therefore, the „ActiSlag“ results regarding the influence of chemical or thermal parameters on glass structure and reactivity, the hydration process and the efficiency of accelerating additions are transferable to the new slags, too.
- Project title: New activation routes for early strength development of granulated blast furnace slag
- Project acronym: ActiSlag
- Project partners: FEhS institute (Duisburg), ArcelorMittal Maizières Research (Metz), Centre National de la Recherche Scientifique (CEMHTI – Conditions Extrêmes et Matériaux: Haute Température et Irradiation, Orleans), University Paul Sabatier (LMDC – Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions, Toulouse), Technical University of Clausthal, Institute for Non-Metallic Materials (Clausthal-Zellerfeld) and ECOCEM Materials Ltd. (Dublin)
- Coordinated by: ArcelorMittal Maizières Research
- Project coordinator: Judith Kaknics
- Project contact at FEhS – Building Materials Institute:
-Ing. Andreas Ehrenberg [Email-Link a.ehrenberg@fehs.de] - Duration: July 2017 to December 2021
- Funding program: European Research Fund for Coal and Steel (RFCS)
- Grant agreement no.: 749809
- Publication: „Report“ of the FEhS institute No. 1/2023

This project has received funding from the European Union’s Research Fund for Coal and Steel under grant agreement No 749809

